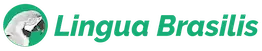Für viele sind Urkundenübersetzungen eine „schnelle“ und „einfache“ Angelegenheit – ein netter Nebenverdienst. Wer aber diese Meinung vertritt, entpuppt sich als nicht fachkundig. Denn bei jeder Urkundenübersetzung – sei es ein langer Schriftsatz oder ein kurzer Führerschein – sind terminologische und kulturelle Informationen zu entziffern und zu übertragen, worüber man sich nicht immer im Klaren ist.
In diesem Beitrag wird mit praktischen Beispielen gezeigt, wie tückisch Urkundenübersetzungen sein können: von scheinbar harmlosen Abkürzungen über falsche Freunde bis hin zu nebelhaften interkulturellen Hintergründen. Außerdem werden Strategien vorgeschlagen, um Fallstricke zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
Es war einmal … eine ganz normale Geburtsurkunde
Ein typisches Dokument auf dem Schreibtisch von Urkundenübersetzern ist die Geburtsurkunde.
In Deutschland gibt es ein nationales Standard-Formular für solche Urkunden, gedruckt vom Verlag für Standesamtswesen. Deshalb könnte man vielleicht erwarten, dass es auch in anderen Ländern so ist.
Leider ist dies nicht der Fall.
Ein solches einheitliches Formular gibt es in Brasilien zum Beispiel nicht, so dass es keinen Sinn hat, von „der“ brasilianischen Geburtsurkunde zu sprechen.
Unterschiedliche Formulare
Zum einen gibt es in Brasilien verschiedene Arten von Geburtsurkunden: tabellarische, in Form eines vollständigen Auszuges aus dem Geburtseintrag, elektronische (nur als Datei oder ausgedruckt durch ein anderes Standesamt), dann auch noch die konsularischen und welche, die aufgrund einer Nachbeurkundung (transcrição) ausgestellt wurden. Es gibt zu viele Varianten, die sich mehr oder weniger voneinander unterscheiden.
Zum anderen werden die Formulare nicht von einem einzigen Verlag gedruckt, sondern von verschiedenen Verlagen auf regionaler und bundesstaatlicher Ebene. Dies hat zur Folge, dass Formulare für die gleichen Arten von Geburtsurkunden nicht gleich sind, auch nicht die, die in demselben Bundesstaat oder in derselben Stadt ausgestellt wurden.
Die Formulare werden von zuständigen Justizbehörden vorgegeben, die Umsetzung der Vorgaben in der Praxis ist jedoch – wie so oft in Brasilien – unterschiedlich.
Außerdem wurde im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Formularen eingeführt, so dass eine Person verschiedene eigene Geburtsurkunden besitzen kann, die sich sehr stark voneinander unterscheiden – nicht nur am Layout, sondern auch inhaltlich, das heißt an behördlichen Formulierungen, Stempelabdrücken und sogar an Personalien.
Unterschiedliche Ortsangaben
Ein Übersetzungsproblem, das mit neueren Formularen für Geburtsurkunden aus Brasilien geschaffen wurde, ist die gleichzeitige Angabe zu naturalidade und local de nascimento.
Früher herrschte nämlich der Konsens, dass naturalidade einfach der Geburtsort ist, und so wird der Begriff auch verstanden in allen anderen Arten von Urkunden (zum Beispiel in Zeugnissen).
Was in neueren Geburtsurkunden jedoch damit gemeint ist, ist der Ort der Zugehörigkeit des Kindes. Maßgeblich hierfür ist laut dem Gesetz Nr. 13.484 vom 26.09.2017 der Ort des Wohnsitzes der Kindesmutter. Dies ist in der Absicht (jedoch nicht in der juristischen Bedeutung) vergleichbar mit dem in der Schweiz verwendeten Begriff von „Heimatort“.
In den aktuellen Geburtsurkunden aus Brasilien findet man also nicht weniger als vier Ortsangaben für das Kind, die alle in der Übersetzung passend wiedergegeben werden müssen:
- naturalidade (Heimatort),
- município de registro (Ort der Geburtsanzeige),
- local de nascimento (Geburtsstätte) sowie
- município de nascimento (Geburtsort).
Bezeichnung von Urkundspersonen
In älteren Geburtsurkunden aus einigen brasilianischen Bundesstaaten kommt oft die Amtsbezeichnung oficial-maior (meistens – unrichtig – ohne Bindestrich) vor. Wortwörtlich bedeutet der Ausdruck „höherer Beamter“. Jedoch handelt es sich dabei nicht um die leitende Urkundsperson des Standesamtes, sondern um die stellvertretende Urkundsperson.
Andere Mitarbeitende in brasilianischen Standesämtern, die in den Urkunden erwähnt werden, sind die escreventes (Schreiber), eine Art Standesamtsgehilfen. Diese werden manchmal escreventes substitutos genannt. Das Wort substituto bezieht sich jedoch nicht auf Stellvertreter eines Schreibers, sondern auf die Tatsache, dass der Schreiber als Stellvertreter des Standesbeamten handelt. Die richtige Übersetzung ist also nicht „stellvertretender Schreiber“, sondern „Schreiber und stellvertretende Urkundsperson“.
Solche Amtsbezeichnungen werden nirgendwo in der Urkunde an sich erklärt. Deren Bedeutungen findet man nur heraus, wenn man alles neugierig hinterfragt, was in einer „ganz normalen“ Geburtsurkunde steht.
Damit enden die Probleme aber noch nicht …
Amtliche Formulierungen
In Geburtsurkunden aus dem Bundesstaat São Paulo findet man häufig folgende Formulierung: Nada mais me cumpria certificar. – wortwörtlich: „Es gab nichts mehr zu bescheinigen.“ Der Satz hat jedoch je nach Kontext zwei unterschiedliche Bedeutungen.
Zum einen bedeutet der Satz: „Meine Beurkundungspflicht habe ich hiermit vollständig erfüllt.“ Gemeint (zumindest theoretisch) ist hier die Tatsache, dass bestimmte Angaben eventuell weggelassen wurden, zum Beispiel die über eine Adoption.
Aber der Satz wird manchmal auch im folgenden Sinn geschrieben und verstanden: „Der Eintrag enthält keine weiteren Angaben.“ Das heißt, die Geburtsurkunde enthält bereits alle (relevanten) Informationen aus dem urschriftlichen Eintrag.
Letztere Bedeutung kann sehr wichtig sein, wenn die betreffende Person heiraten will, denn sie bedeutet auch: „… keine weiteren Angaben, auch nicht über etwaige Eheschließungen“. Ob er auch in anderen brasilianischen Bundesstaaten außerhalb São Paulo oder in Deutschland genau so verstanden wird, das hängt von der Lesart ab.
Urkundenübersetzer müssen in jedem Fall auf scheinbare Kleinigkeiten wie diese achten.
Bezeichnungen von ausstellenden Behörden
Ein weiteres Problemfeld von brasilianischen Geburtsurkunden sind die Bezeichnungen der ausstellenden Behörden. Als Aussteller von Geburtsurkunden führen brasilianische Standesämter unterschiedliche Bezeichnungen, je nachdem, in welchem Bundesstaat sie sich befinden. Der größte Unterschied besteht in der Verwendung von Wörtern wie
- Cartório (Kanzlei der freiwilligen Gerichtsbarkeit),
- Serviço Registral (Registeramt) oder
- Escrivania de Paz (Geschäftsstelle eines Friedensrichters).
Hinzu kommen Zusatzbezeichnungen wie beispielsweise der
- Stadtbezirke (regiões administrativas wie in São Paulo),
- Stadtteile (bairros wie in Curitiba),
- Justizbezirke (zonas judiciárias wie in Recife) oder
- in der Kolonialzeit gegründeten (Kirchen)Verwaltungsbezirke (freguesias wie in Salvador).
Es kommt auch vor, dass das die Bezeichnung des Standesamtes den Nachnamen der aktuell leitenden Urkundsperson oder der Urkundsperson, die es gegründet hat (könnte der Vater oder die Mutter der Ersteren sein), enthält.
Das Verständnis dieser Bezeichnungen ist wichtig, um bestimmte Elemente und Aussagen im Text einordnen zu können, wenn zum Beispiel mehrere Stempelabdrücke von verschiedenen Behörden übersetzt werden müssen.
Wie erkennt man als Urkundenübersetzer all diese interkulturellen Hintergründe? Indem man sich nicht nur mit der Ausgangssprache, sondern mit dem Land der Ausgangssprache intensiv auseinandersetzt. Und sich darauf spezialisiert, statt alle möglichen Dokumente aus allen Ländern der Ausgangssprache übersetzen zu wollen.
Im Laufe der Zeit sammelt man mit dieser Strategie einen Riesenfundus an authentischen Dokumenten aus dem betreffenden Land, den man bei Bedarf durchsuchen kann.
Die Strategie führt zwar nicht zu einer Automatisierung des Übersetzungsprozesses bei vermeintlich „einfachen“ Urkunden, aber sie erleichtert in der Tat die Arbeit, weil man es dann mit einem besonders vertrauten kulturellen Raum zu tun hat.
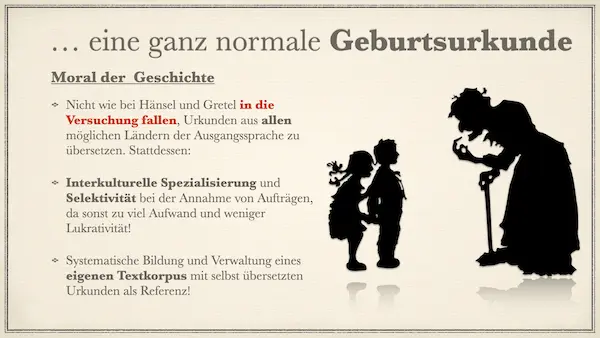
Ein ganz normaler Führerschein
Auch Führerscheine sind häufig Gegenstand von Urkundenübersetzungen. Und auch hier bereiten einige scheinbar harmlose Formulierungen Übersetzungsprobleme.
Veränderung von Behördenbezeichnungen
Die Bezeichnung für die obere Behörde, unter der die brasilianischen Straßenverkehrsämter arbeiten, hat sich im Laufe der Jahre verändert. Sie hieß früher Ministério das Cidades (brasilianisches Bundesministerium für Kommunalwesen), in den Jahren 2019-2022 heißt sie Ministério da Infraestrutura (brasilianisches Bundesministerium für Infrastruktur). (Übrigens: Das 2019 abgeschaffte Ministério das Cidades wurde von der neuen brasilianischen Regierung wieder eingeführt.)
Wer also im „automatischen Modus“ schnell übersetzen will und das falsche Führerschein-Formular als Übersetzungsvorlage verwendet, läuft Gefahr, bereits in der zweiten Zeile einer scheinbar „einfachen“ Urkunde einen Übersetzungsfehler zu begehen.
Verwirrende Fachausdrücke
Im brasilianischen Nationalen Führerschein gibt es ein Feld mit der Bezeichnung Permissão. Die wortwörtliche Übersetzung wäre hier nicht angebracht, denn es handelt sich dabei nicht um die eigentliche „Fahrerlaubnis“, sondern um die „vorläufige Fahrerlaubnis“, die man in manchen Fällen vor Ausstellung des endgültigen Führerscheins bekommt (Führerschein auf Probe).
Das Feld wird verständlicherweise mit einem dicken horizontalen Balken gefüllt, was bedeutet, dass es ungültig oder nicht relevant ist. Eine wortwörtliche Übersetzung würde aber den Eindruck erwecken, dass die betreffende Person gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Sehr gefährlich!
Aufzulösende Abkürzungen
Die Führerscheinklassen werden als Abkürzungen aufgelistet – und zwar ohne Kommata. Das heißt, es werden nicht die Führerscheinklassen A und B ausgewiesen, sondern AB.
Diese Abkürzungen müssen nicht nur aufgelöst, sondern auch erklärt werden.
Hier hilft ein Blick in die brasilianische Straßenverkehrsordnung (Código de Trânsito Brasileiro), um zu einer schlüssigen und neutralen Erklärung der Führerscheinklassen zu kommen, die man bei künftigen Führerschein-Übersetzungen verwenden kann, ohne dass dies als juristische Deutung gesehen wird.
Führerscheinstellen als Aussteller von Ausweisen
Führerscheine gelten in Brasilien als vollwertige amtliche Ausweise und werden auch oft als solche verwendet – als Zeichen von Status: Man besitzt ein Auto!
In vielen notariellen, gerichtlichen und sonstigen Urkunden, in denen Personalien aufgelistet werden, findet man deshalb die merkwürdige Information, dass die „ausstellende Behörde“ des Personalausweises ein „Straßenverkehrsamt“ war. Was natürlich nicht stimmt.
Denn diese Angabe bedeutet lediglich, dass die Nummer des Personalausweises dem Führerschein entnommen wurde. Das heißt: Man wird nach dem Ausweis gefragt, weist den Führerschein vor und die Amtsperson schreibt die Personalausweis-Nr., die dort zu lesen ist, auf.
Urkundenübersetzer müssen in der Lage sein, diesen Aspekt der brasilianischen Gesellschaft zu erkennen, denn sonst ist die Übersetzung falsch.
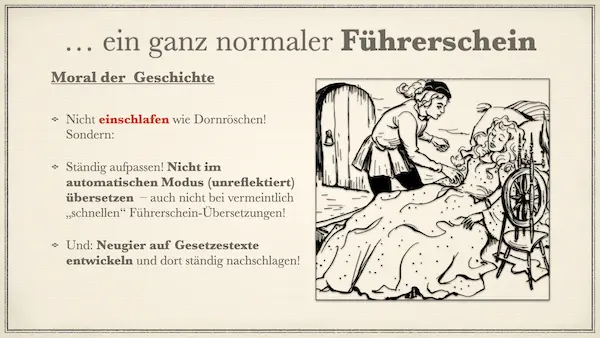
Ein ganz normales Zeugnis
Urkundenübersetzer nennen oft Zeugnisse und sonstige Bildungsnachweise als Beispiele für Dokumente, die sie am häufigsten übersetzen. Und diese werden leider auch als eine Art Lebensversicherung behandelt von Übersetzern, die sich nicht spezialisiert haben. Dabei gehören Zeugnisse zu den schwierigsten Übersetzungsdokumenten überhaupt – nicht nur, weil die Terminologierecherche und die Formatierung sehr zeitaufwändig sein können, sondern auch, weil solche Urkunden aufgrund mangelnder Einheitlichkeit versteckte Gefahren aufweisen.
Verschiedene Notensysteme
Das größte Problem bei brasilianischen Zeugnissen ist wohl die Tatsache, dass es in Brasilien nicht das eine Notensystem gibt, sondern gleich mehrere – je nach Bundesstaat, Ort, Schule sowie Ausstellungsjahr.
Es gibt die Noten von 0 bis 10, von 0 bis 100, von 0 bis 60, von A bis E oder auch verschiedene Notensysteme in Worten statt Ziffern.
Dabei wird das jeweils gültige Notensystem selten im Zeugnis erklärt, was zu Verständnisschwierigkeiten führt.
Das Problem wird noch schlimmer, wenn eine ausstellende Schule Angaben aus früheren Schulen wiedergeben muss. Dann kann es nämlich passieren, dass das Zeugnis so viele unterschiedliche Notensysteme enthält, dass es für Urkundenübersetzer sehr gefährlich wird, irgendwelche Anmerkungen dazuzuschreiben.
In solchen Fällen hilft zunächst ein Besuch auf der Website der Bildungsdirektion (Coordenadoria Estadual de Educação), welche typischerweise die geltenden gesetzlichen Bestimmungen in deren Zuständigkeitsgebiet veröffentlichen müssen; die Schulen selbst haben auf deren eigenen Websites, falls es diese überhaupt gibt, kaum nützliche Informationen hierüber.
Unübersichtliche Einteilung der Schuljahre
Die Einteilung der Schulbildung ist in Brasilien trotz der Gesetzgebung auf Bundes- und regionaler Ebene ebenfalls nicht einheitlich. In einigen Bundesstaaten gibt es neben den Klassen (séries) auch noch Abschnitte (ciclos) und Stufen (fases).
Außerdem weisen neuere Zeugnisse aus den letzten circa zehn Jahren eine neue Nummerierung der Schuljahre auf, denn es gilt in Brasilien theoretisch die Primarbildung in neun Jahrgangsstufen, was eigentlich acht Klassen und ein diesen vorangehendes Alphabetisierungsjahr bedeutet.
Viele Schulen verstehen die Verwirrung und listen die Jahrgangsstufen neben den entsprechenden Klassen auf. Andere wiederum schweigen komplett darüber, so dass Urkundenübersetzer nicht sofort wissen können, wie viele Jahre eigentlich absolviert wurden und was genau in der Übersetzung stehen soll.
Übrigens: Nach den acht Klassen bzw. neun Jahrgangsstufen fängt die Nummerierung der Schuljahre neu an, und dann nur mit der Bezeichnung séries (Klassen). So heißt die Jahrgangsstufe 10 1ª série (der Sekundarbildung), die gleiche Bezeichnung wie die Klasse 1 (Jahrgangsstufe 2): 1ª série (der Primarbildung).
Für Urkundenübersetzer, die ein Translation-Memory-System nutzen, stellt dies natürlich ein Problem dar, denn in diesem Fall hat ein einziges Segment in der Ausgangssprache zwei sehr verschiedene Übersetzungen.
Bezeichnung von Bildungseinrichtungen
Ein weiteres terminologisches Problem bei brasilianischen Hochschulzeugnissen besteht in den Bezeichnungen der Bildungseinrichtungen, die die Zeugnisse ausgestellt haben. Denn es gibt in Brasilien verschiedene Arten von Hochschulen, und die Lage ist viel unübersichtlicher als in Deutschland.
Eine davon sind die faculdades. Diese sind meistens keine Fakultäten – die beiden Bezeichnungen sind sogenannte „falsche Freunde“ – sondern eigenständige Hochschulen ohne Promotionsrecht. Sie unterscheiden sich kaum von den Centros Universitários und Institutos Superiores, die ebenfalls keine Universitäten (universidades), sondern Hochschulen sind.
Bei den Schulen gibt es wiederum häufig das Problem, dass die Schulbezeichnung teilweise eine Abkürzung enthält, die in den meisten Fällen aufgelöst werden müsste, zum Beispiel:
- EEPSG (Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus), zu Deutsch: bundesstaatliche Primar- und Sekundarschule, oder
- EMEFM (Escola Municipal de Ensinos Fundamental e Médio), zu Deutsch: kommunale Primar- und Sekundarschule.
Das alles muss man immer im Hinterkopf haben bei der Übersetzung von Zeugnissen, in denen die Bezeichnung der ausstellenden Bildungseinrichtung eine wichtige Rolle spielt und mit übersetzt werden muss.
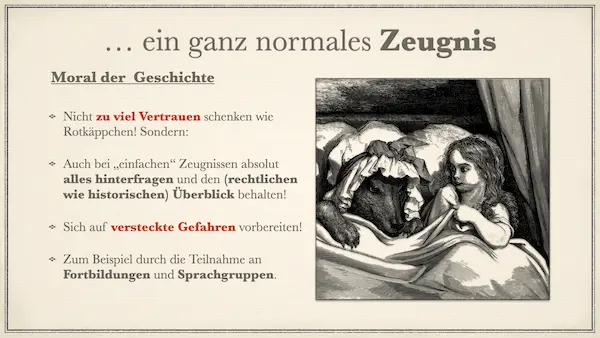
Weitere „einfache“ Urkunden
Die Apostille und die Gefahr des automatischen Übersetzungsmodus
Die Haager Apostille wurde erst 2016 in Brasilien eingeführt. Das Formular dazu ist im ganzen Land zwar einheitlich, seit der Einführung wurde es jedoch bereits zweimal leicht geändert: Die Versionen von 2019 und 2021 enthalten jeweils am Ende eine unterschiedliche Telefonnummer und E-Mail-Adresse für die Ansprechpartner sowie in manchen Fällen auch eine neue Art der Nummerierung.
Falls die Apostille übersetzt werden muss (was bei Urkunden aus dem Nicht-EU-Land Brasilien häufig verlangt wird) und wenn die Übersetzung nicht wie sonst sorgfältig gemacht wird (Stichwort: unüberlegter, automatischer Übersetzungsmodus!), ist es ganz leicht, die Unterschiede in den Formularen zu übersehen.
Dies führt zu einer schlechteren Übersetzungsqualität, auch wenn solche Details im Grunde genommen zu den unwesentlichen Textelementen zählen sollten.
Scheidungsurteile und die Gefahr der justiziellen Zuständigkeiten
Bei brasilianischen Scheidungsurteilen kommt die Behörde Ministério Público oder Promotoria Pública immer wieder zu Wort. Es handelt sich dabei um die Staatsanwaltschaft. Aber was hat die Staatsanwaltschaft mit einer Scheidungssache zu suchen?
In Brasilien hat sie nämlich andere Zuständigkeiten als in Deutschland und kann beispielsweise nicht nur in der Strafverfolgung, sondern auch als Verfahrensbeistand in Zivilsachen, in der Rechtspflege oder in der Rechtsaufsicht tätig sein.
Auch hier ist das Wissen über interkulturelle Zusammenhänge und die Praxis der Justizverwaltung von Vorteil für Urkundenübersetzer, um seltsame Formulierungen zu vermeiden, wie zum Beispiel „Die Staatsanwaltschaft hat die Stattgabe des Scheidungsantrags befürwortet“ (seltsam natürlich nur, wenn keiner der Scheidungswilligen im Gefängnis sitzt).
Notarielle Urkunden und die Gefahr der falschen Anrede von Amtspersonen
In Brasilien sind zugelassene Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Richter aufgrund eines Gesetzes aus dem Jahr 1827 (über die Gründung juristischer Hochschulen) berechtigt, den Doktortitel zu führen (doutor). Diese Anrede findet man relativ oft in notariellen Urkunden.
Es wäre aber falsch, die betreffenden Personen in deutschsprachigen Übersetzungen als Doktoren zu bezeichnen – nicht nur, weil der brasilianische Titel kein Doktortitel im eigentlichen Sinne ist, sondern auch weil es sich um einen Ehrentitel handelt. Deshalb kann man in diesem Fall die Anrede weglassen.
Interessanterweise führen brasilianische Notare, die in der Regel Juristen sind, fast immer nicht die Anrede doutor, sondern den Titel bacharel, was bedeutet, dass sie ein abgeschlossenes Jurastudium hinter sich haben, jedoch nicht als Anwälte zugelassen sind. In diesem Fall kann man den Titel bacharel mit „Jurist“ übersetzen.
Fazit
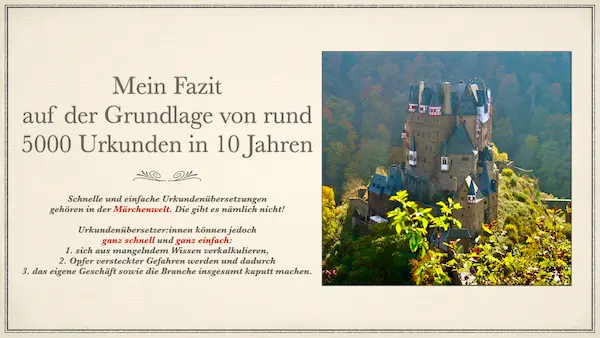
Mit den vorstehenden Beispielen aus der Praxis wurde hoffentlich gezeigt, dass auch „ganz normale“ Urkunden eine Vielzahl von Problemen und Nuancen aufweisen, die nicht immer leicht zu erkennen sind.
Um Urkunden kompetent übersetzen zu können, braucht man nicht nur eine solide Ausbildung im Übersetzungsbereich, sondern auch breites und tiefes interkulturelles Wissen über das Land der Ausgangssprache (Stichwort Spezialisierung!) sowie eine stets kritische Auseinandersetzung mit und permanente Aufmerksamkeit bei jeder noch so kurzen Urkunde.
Urkundenübersetzer schaden daher nicht nur sich selbst, sondern auch den Kunden und der Übersetzungsbranche im Allgemeinen, wenn von „einfachen“ und „schnellen“ Urkundenübersetzungen die Rede ist.
[Dieser Text ist eine ausgearbeitete Version von einem Vortrag, den ich im September 2022 im Rahmen der 7. Fachkonferenz Sprache und Recht in Berlin abgehalten habe. Er wurde im Tagungsband der Konferenz veröffentlicht.]